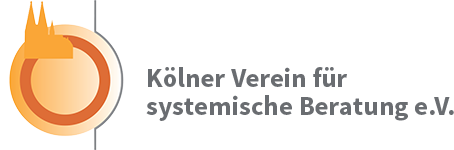Alle reden von Krise: Wir auch – aber anders!
von Annegret Sirringhaus-Bünder
Seit ich Corona-bedingt morgens mehr Zeit habe, schaue ich nach dem Frühstück gerne etwas länger in die Zeitung – und finde auf den ersten Blick nur noch Berichte über „Corona“! Wie gerne würde ich wieder einmal etwas anderes lesen! Man müsste einmal zählen, wie oft in einer Ausgabe der Tageszeitung, in Hörfunk oder TV-Nachrichten bzw. Kommentaren in diesem Zusammenhang das Wort „Krise“ benutzt wird! Es klingt so, als wenn es eine stillschweigende Übereinstimmung darüber gäbe, dass die Corona-Pandemie alle und alles in eine „Krise“ gestürzt hat und dass wir alle darunter das Gleiche verstehen!
Meine Beobachtung zeigt, dass Menschen diese Zeit höchst unterschiedlich erleben. Es ist längst nicht das Gleiche, ob Freiberufler*innen, Selbständige, Inhaber kleiner Restaurants oder Geschäfte, Frisöre oder andere Dienstleister*innen um ihre wirtschaftliche Existenz bangen müssen oder das medizinische Personal schon längst jenseits seiner Belastbarkeitsgrenzen arbeitet. Inzwischen ist auch bekannt, dass der Aggressionspegel in vielen Familien steigt, wo Eltern und Kinder notgedrungen den ganzen Tag auf engem Raum „aufeinanderhocken“ müssen. Wenn beide Elternteile im sog. Home-Office arbeiten, ihre Kinder in unterschiedlichen Altersstufen und aus verschiedenen Schulformen dazu angehalten werden müssen, ein tägliches Lernpensum zu absolvieren, wenn dann alle viel zu wenig Bewegung haben, schnellt leicht der Stresspegel in die Höhe. Wiederum ganz anders werden es alte Menschen in den Alten- und Pflegeheimen erleben, die in ihren Zimmern von der Umwelt und ihren Angehörigen abgeschnitten vereinsamen, oder Sterbende, denen „großzügigerweise“ das Telefon ans Ohr gehalten wird, damit sich ihre Lieben von ihnen ein letztes Mal verabschieden können! Wieder völlig anders wird es für ein Rentnerehepaar aus der Mittelschicht sein, das zwar den direkten Kontakt zu Kindern, Enkeln und Freunden vermisst, aber ansonsten in Haus und Garten herumwerkelt, Spaziergänge macht und das schöne Wetter genießt, usw.
Es ergibt daher Sinn, vorsichtig, d. h. hier differenziert, mit dem Begriff „Krise“ umzugehen! Noch lange nicht jede Schwierigkeit oder Herausforderung, die es zu bewältigen gilt, ist auch gleich eine Krise!
Nach Dross (2001) ist „eine Krise […] ein zeitlich begrenzter Zustand mit einem identifizierbaren Auslöser, indem ein Verlust, eine Schädigung, Bedrohung oder Überforderung eintritt, durch den der Fortgang des bisherigen Lebens unterbrochen wird“. Etymologisch ist der Begriff Krise auf das griechische Verb „krisein“ zurückzuführen in der Bedeutung von scheiden (trennen), auswählen, beurteilen, entscheiden, streiten und kämpfen. Das lateinische Wort „crisis“ bezieht sich auf medizinische Zustände und ist mit zwei Bedeutungen assoziiert: Gefahr (Tod) und Chance (Heilung, Leben). Im engeren medizinischen Sinne war und ist die Krise der Höhepunkt (Kulmination) und gleichzeitig der gute Wendepunkt bei einem Fieberanfall, der die Entscheidung zur Heilung anzeigt. Im 18. Jahrhundert wird der Begriff Krise zum ersten Mal auch auf gesellschaftliche Zustände bezogen. Seit dem 19. Jahrhundert wird er zunehmend auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen, wie Philosophie, Pädagogik, Psychologie, Soziologie und Politik, verwendet. Im Chinesischen bedeutet das Wort Krise einerseits Gefahr, andererseits aber auch Chance.
Eine Krise zeichnet sich dadurch aus, dass sie zeitlich begrenzt ist und in der Regel mit alten Strategien nicht bewältigt werden kann. Wer sich in einer Krise befindet, steht an einem Punkt einer notwendigen Entscheidung, die entweder positiv in Form von Lernen neuer Strategien und Entwicklung eines neuen Identitätserlebens ausgeht oder aber negativ in Form von Niedergeschlagenheit, Depression oder einem Suizidversuch endet. Aufgrund der extremen Angst durch die existenzielle Bedrohung, die wir in dieser Situation empfinden, wird der Entscheidungsprozess erschwert oder gar verhindert, weswegen bei Kriseninterventionen als Erstes versucht wird, die innere Einengung und damit die Angst etwas zu lösen.
Eine Krise liegt also dann vor, wenn die üblichen „Bordmittel“, die man persönlich durch Lebenserfahrung oder innerhalb des sozialen Netzes zur Verfügung hat, um eine Schwierigkeit oder eine schwierige Lebenssituation zu bewältigen, versagen bzw. nicht (mehr) ausreichend zur Verfügung stehen!
Sonneck (1995) unterscheidet zwischen drei Formen einer Krise: der Veränderungskrise, der sog. Chronisch-protrahierten Krise und der Traumatischen Krise.
Veränderungen sind Teil unseres Lebens. Ohne Veränderungen gäbe es keine Entwicklung. So werden zahlreiche Lebensveränderungen von den meisten Menschen auch als normal empfunden, beispielsweise, wenn Kinder in eine neue Entwicklungsphase kommen und sich die Eltern darauf einstellen müssen, dass ihre Kinder selbstständiger sein wollen und weniger Schutz und Hilfe benötigen. Das elterliche Verhalten muss sich an die neuen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder anpassen. Genauso erfordert jeder berufliche Wechsel eine Anpassung an die Arbeitsbedingungen und Umgangsregeln der neuen Arbeitsstelle.
Manche Veränderungen werden schicksalhaft und problematisch empfunden, weil sie einen radikalen Einschnitt in bisherige Lebensabläufe darstellen, wie beispielsweise der Verlust der Arbeitsstelle, die Trennung vom Lebenspartner oder eben wie jetzt die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Ob daraus eine Veränderungskrise entsteht, ist davon abhängig, welche Möglichkeiten den Betroffenen zur Verfügung stehen, um die ggf. auftretenden Schwierigkeiten in dieser Lebenssituation zu meistern.
Hier das Beispiel einer Familie mit drei Kindern, der es gelungen ist, aus den Corona-bedingten Veränderungen keine Krise entstehen zu lassen: Je eins der Kinder besucht den Kindergarten, die Grundschule und eine weiterführende Schule. Vor der Schließung von Schule und Kindergarten gingen beide Eltern einer Bürotätigkeit nach. Die Kinder blieben an fünf Tagen in der Woche in der Ganztagsbetreuung von Schule und Kindergarten. Die verbleibende Zeit wurde in der Familie sehr offen, wie es sich gerade ergab zu Hause, mit Freunden oder mit gemeinsamen Familienaktivitäten verbracht. Seit der verfügten Ausgangssperre sind alle fünf Familienmitglieder ständig zu Hause. Beide Eltern arbeiten im Home-Office. Die Schulkinder haben unterschiedliche Aufgaben (Arbeitsblätter) zu erledigen, das Kindergartenkind möchte beschäftigt werden. Die Familie ist zu allen Mahlzeiten zu Hause. Es muss also mehr eingekauft und regelmäßig gekocht werden. Wenn jetzt die Eltern ihr „übliches“ (Freizeit-)orientiertes Verhalten beibehalten würden, käme es schnell zu Chaos und Stress. Bereits am zweiten Tag der Ausgangssperre sagte die Mutter: „Ich muss jetzt unser gesamtes Familienleben neu organisieren!“ Konkret sieht es jetzt in dieser Familie folgendermaßen aus: Es gibt eine feste Uhrzeit, wann die Familie morgens aufsteht und gemeinsam frühstückt – wenn auch nicht ganz so früh wie in „normalen“ Zeiten. Am Vormittag gibt es zwei Stunden Lernzeit für die „Großen“, in denen die Kleine Bilder malt, mit denen sie dann die Großeltern beglückt. Die Einkäufe von Lebensmitteln werden soweit wie möglich auf einmal wöchentlich reduziert. Mittags essen alle gemeinsam eine warme Mahlzeit. Abends gibt es ebenfalls eine feste Zeit für das gemeinsame Abendessen. Die Kinder haben Zeiten, in denen sie miteinander oder auch einzeln in ihren Zimmern spielen können, während die Eltern im Home-Office arbeiten. Dies ist für die Mutter schwieriger zu organisieren als für den Vater, weil sie für die Kinder „sprungbereit“ ist und daher oft noch abends, wenn die Kinder schlafen, arbeitet. Immer, wenn das Wetter es möglich macht, geht der Vater mit den beiden Jungen joggen, die Mutter begleitet sie mit der kleinen Tochter auf dem Fahrrad. Am Wochenende gibt es gemeinsame Familienausflüge in die Natur. Was selbstverständlich alle vermissen, sind die Kontakte zu Freunden und den Großeltern. Dies wird mit der Gewissheit, dass auch „Corona“ einmal enden wird, hingenommen! O-Ton der Mutter: „Bei uns geht es total entspannt zu! Von mir aus könnte es noch eine Weile so bleiben!“ – Diese Familie hat es also geschafft, sich an die neue Situation, die sie nicht selbst gewählt hat, anzupassen und wird mit Sicherheit auch langfristig davon profitieren. Hilfreich ist dabei unter anderem, dass sie genügend Wohnraum haben, um sich auch einmal aus dem Weg gehen zu können!
Wenn sich eine Lebenssituation allerdings so verändert, dass man mit dem üblichen Problemlöseverhalten nicht weiterkommt, die Situation sich nicht positiv verändern lässt, Spannungen und Unbehagen bestehen bleiben oder sogar zunehmen, kann eine Veränderungskrise entstehen. Wird jetzt versucht, mehr von demselben (Lösungs-) Verhalten zu zeigen, welches die Dinge nicht ändert, führt dies unter Umständen zu einem Anstieg der inneren und ggf. auch äußeren Spannungen und des subjektiven Gefühls von Unbehagen, Hilflosigkeit, bis hin zu Gefühlen von Ausweglosigkeit und Resignation, d. h. zu dem Gefühl, sich in einer Krise zu befinden.
In der Süddeutschen Zeitung vom 15.04.2020 ist unter der Überschrift „Alles weggebrochen“ nachzulesen, wie die Opernsängerin Katrin Valk die Krise angeht. „Auf der Homepage der Dresdner Semperoper kann man sogar noch Karten kaufen für die Premiere von Giacomo Puccinis ‚Madame Butterfly‘ am 26. April. Die Proben dafür hätten vor vier Wochen beginnen sollen; sie wurden abgesagt. […]. Ob die anderen Stücke, für die sie engagiert ist, geprobt und aufgeführt werden können, weiß die 39-jährige Katrin Valk nicht. Die Mezzosopranistin Valk ist freiberufliche Opernsängerin – und hat gerade keine Ahnung, wann sie wieder auch nur einen Euro verdient: „Es ist beängstigend. Von einem Tag auf den anderen ist alles weggebrochen, das ganze Berufsleben. […] Staatliche Unterstützung gibt es zwar, aber wer von wem wieviel bekommt, das ist unübersichtlich.“ Katrin Valk versucht, nicht bitter zu klingen. Es gelingt ihr nicht immer. Sie versucht, ihre Stimme fit zu halten, einstudierte Stücke zu wiederholen, sich neue anzuschauen, Italienisch zu lernen. Aber wer nicht weiß, was die Zukunft bringt, wird kaum motiviert. Und wer den ganzen Tag über angespannt ist, kann sich nicht freuen über all die Zeit, in der nun endlich Fotos sortiert werden können. „Ehrlich gesagt, man gammelt, was soll man machen. Es ist ja egal, wann man etwas macht. […] Jetzt bin ich selbst fit, aber mein Berufsfeld ist nicht mehr existent. Und ich weiß nicht wann es wieder existiert. Ich fühle mich wie aus dem Leben geschnitten.“
Hier treten die Merkmale einer Veränderungskrise deutlich hervor: Finanzielle Einbußen, die zu ernsthaften Existenznöten führen können, keine klare Information, ab wann es welche staatlichen Hilfen geben wird oder wann die Situation endet, Wegfall der üblichen Tagesstruktur, kein Ziel, woraufhin es sich lohnen würde zu üben und sich fit zu halten. Die Dinge, mit denen sie sich beschäftigen könnte, erscheinen beliebig und sind daher in der Gefahr als sinn- und planlos erlebt zu werden. Wenn eine solche Veränderungskrise gut bewältigt werden will, braucht es eine Anpassungsleistung des eigenen Verhaltens an die nun veränderte Situation. Es braucht die Idee, genau in dieser Realität einen Sinn zu finden. Ein oft zitiertes Beispiel ist hier Viktor Frankl, der während und nach seiner Zeit im Konzentrationslager herausgestellt hat, dass diejenigen mit diesen schrecklichen Erfahrungen am besten leben konnten, die in der Lage waren, ihrer Zeit und ihrem Erleben dort einen Sinn zu geben. Dabei war es mehr oder weniger unbedeutend, um welchen Sinn es sich inhaltlich handelte, also ob er religiös, weltanschaulich oder beispielsweise als Lern- und Entwicklungsaufgabe verstanden wurde.
Die persönlichen Reaktionen auf plötzlich auftretende oder auch erwartete Schwierigkeiten sind erfahrungsgemäß höchst individuell. Das, was eine Person bereits in Panik versetzt, kann für eine andere ein Ansporn sein, andere, neue Wege zu finden, die eigenen Ziele zu verändern oder dem, was gerade erlebt wird, eine andere Bedeutung zu geben. In der gleichen Tageszeitung (Süddeutsche Zeitung) sind durchaus interessante Berichte nachzulesen, was Menschen tun, um mit der derzeitig einschränkenden und bedrohlichen Situation umzugehen. Da wird beispielsweise von einem „Sternekoch“ berichtet, der sein Restaurant schließen musste, aber nicht aufhörte zu kochen, sondern zunächst aus den Lebensmitteln in seinen Kühlschränken Mahlzeiten für Bedürftige kochte und als seine Vorräte aufgebraucht waren, dies mit gespendeten Lebensmitteln fortsetzte. Oder die Physiotherapeutin, die ihre Praxis schließen musste und sich freiwillig für Pflegearbeiten in einem Altenheim meldete. Viele Kolleginnen und Kollegen, die freiberuflich als Berater*innen, Supervisor*innen oder Therapeut*innen tätig sind, bieten aktuell ihre Leistungen On-line oder telefonisch an, um auf diesem Weg Kontakt zu ihren Klientinnen/Klienten oder Patientinnen/Patienten zu halten und die Versorgung von Menschen mit Beratungs- und Therapiebedarf nicht abbrechen zu lassen. Viele folgen einem Aufruf auf der Homepage der „Deutschen Gesellschaft für systemische Therapie, Beratung und Familientherapie“ (DGSF), einfache Hilfsmethoden auf einer Internetplattform für Familien mit kleinen Kindern zur Verfügung zu stellen, und vieles andere mehr.
Wenn der Alltag, wie in dieser Zeit der Pandemie, nicht auf die gewohnte Weise weitergehen kann, heißt dies eben nicht in jedem Fall, dass gar nichts mehr geht, sondern dass wir andere Möglichkeiten wahrnehmen, neue Ideen entwickeln können, wenn wir nur unsere Blickrichtung ändern. Konkret hieße das: Erstarre nicht beim Blick auf das, was im Moment nicht geht, sondern wende dich um und schaue auf das, was unter diesen Bedingungen möglich ist. Dies bedeutet nicht, das Schlechte und Schlimme „schönzureden“! Auch hierzu fand ich eine passende Überschrift in der Süddeutschen Zeitung vom 07.04.2020, Seite 8: „Jetzt mal halblang. Japanisch lernen, Brot backen und dabei immer schön fit bleiben: Warum müssen wir uns eigentlich selbst in der Krise noch optimieren?“ Eine solche unnötige Übertreibung erhöht eher den Stress und steigert damit möglicherweise das Krisenerleben, weil die Gefahr besteht, dass das Gefühl zu versagen hinzukommt, wenn die nun freie Zeit angeblich nicht optimal genutzt wird. Das bedeutet: Zu dem Durchleben einer Krise gehören Gefühle von Sorge, Angst, ggf. Trauer, Orientierungslosigkeit usw. genauso wie zu einer positiven Erfahrung Gefühle von Freude, Glück, Stolz! Wenn ich sie als berechtigt und angemessen in dieser Situation anerkenne, kann es mir eher gelingen, sie wahrzunehmen, ohne dass sie mich überwältigen, um dann wieder Zugang zu meinen eigenen oder von außen angebotenen Möglichkeiten zu finden.
Je mehr ich aber versuche, diese „negativen“ Gefühle zu unterdrücken, sie mit Aktivitäten zu überspielen oder sie gar zu ignorieren, desto mehr werden sie sich aufstauen und mich zu überschwemmen drohen. Wenn eine Veränderungskrise nicht als Herausforderung und mit der Bereitschaft, die eigene Einstellung und das eigene Verhalten zu verändern, angenommen wird, kann es stattdessen zur Entwicklung sog. destruktiver Bewältigungsmuster kommen. Man versucht, der Bedrohung und den damit verbundenen belastenden Gefühlen aus dem Weg zu gehen. „Beliebte“ Mittel dazu können beispielsweise erhöhter Alkoholkonsum, Medikamentenmissbrauch oder auch Gewalttätigkeit sein.
Die Folge dieser Art der versuchten „Problemlösung“ ist leider meistens eine Vergrößerung der Probleme, d. h., das Krisenerleben steigert sich, kann überwältigend und dauerhaft und damit zu einer chronisch-protrahierten Krise werden. Manchmal sind es „kleine“ Anlässe, wie beispielsweise die vermeintliche Aufsässigkeit eines Kindes oder ein Streit zwischen Eheleuten, eine unerledigte Arbeit, die zum „Tropfen werden, der das Fass zum Überlaufen bringt“. Es kommt z. B. zu lautstarkem Streit, Gewaltausbrüchen, Übergriffigkeit, Missbrauch u. v. a. m., die die Situation auch nach außen als akute Krise erscheinen lassen. Eine chronisch-protrahierte Krise kann also auf den ersten Blick wie eine Veränderungskrise wirken. Beim genaueren Nachfragen stellt sich aber heraus, dass sie eine oftmals längere Geschichte nicht bewältigter Veränderungskrisen hat. Menschen, deren Leben auch schon vor der Corona-Pandemie von zahlreichen unbewältigten Problemen gekennzeichnet war, können durch die aktuelle Situation verstärkt das Gefühl von Aussichtslosigkeit und Resignation entwickeln: „Es nützt ja doch alles nichts!“ Wer versucht zu helfen oder zu unterstützen, stößt hier häufig auf Reaktionen von Hilflosigkeit, auf Vermeidungsverhalten, körperliches Unbehagen oder Flucht in Krankheit, subdepressive Stimmung, die Tendenz, Verantwortung abzugeben, Kontaktvermeidung oder Misstrauen. Bevor Hilfe und Unterstützung greifen können, gilt es hier, die Veränderungsmotivation zu klären und soweit wie möglich aufzubauen. Es besteht die große Gefahr, dass Helfende sich nach einer Zeit ergebnisloser Bemühungen frustriert und/oder ausgebrannt zurückziehen. Daher nennt Sonneck (1995) als erste Ziele: Information, Aufklärung und Beratung. Erst dann kann es um konkrete Verhaltensänderungen gehen, wie beispielsweise Wiedererwerb von Vertrauen in die eigenen Kompetenzen, Abbau von Schon- und Vermeidungsverhalten, konstruktiver Umgang mit Gefühlen von Angst und Unsicherheit in kritischen Situationen, Aufgeben der Krankenrolle (bei Flucht in die Krankheit), Erlernen von Entspannungstechniken, kritischer Umgang mit Suchtmitteln und Rückfallprophylaxe.
Die dritte Form der Krise, die traumatische Krise, definiert Sonneck (1995) als „eine plötzlich aufkommende Situation von allgemein akzeptierter schmerzlicher Natur, die auf einmal die psychische Existenz, die soziale Identität und Sicherheit und/oder die fundamentalen Befriedigungsmöglichkeiten bedroht.“ Aber Vorsicht! Nicht jede schwere, einschneidende, schmerzhafte und bedrohliche Erfahrung ist ein Trauma oder führt danach zu posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS)! Von einem Trauma sprechen wir erst bei einer sehr schwerwiegenden körperlichen und/oder seelischen Verletzung durch ein schmerzhaftes Erlebnis, durch das sich eine Person extrem bedroht fühlt und aus der sie sich nicht selbst befreien kann.
Ähnlich wie bei dem Begriff Krise finden sich auch in Bezug auf den Begriff Trauma unterschiedliche Definitionen und eine Neigung, den Begriff inflationär zu gebrauchen. In der Presse wurde beispielsweise im Zusammenhang mit mehreren verlorenen Fußballspielen von einem „Trauma“ für den betroffenen Verein gesprochen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert ein Trauma als „ein kurz- oder langanhaltendes Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“.
Die deutsche Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) versteht unter dem Begriff „Trauma (griech. Wunde) eine „seelische Verletzung“, zu der es bei einer Überforderung der psychischen Schutzmechanismen durch ein traumatisierendes Erlebnis kommen kann.“ Man geht statistisch davon aus, dass weltweit ungefähr 75 % der Erdbevölkerung im Lauf ihres Lebens eine traumatische Erfahrung machen. Jedoch entwickeln nicht alle Menschen, die ein traumatisches Ereignis erlebt haben, auch eine Trauma-Folgestörung. Bei nur etwa einem Viertel der Betroffenen tritt nach dem traumatischen Ereignis eine solche psychische Störung auf, die sich in der Regel in Form von sog. Flashbacks, ständig wiederkehrenden Alpträumen oder als dissoziative Störung zeigen kann.
Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kann eine traumatische Erfahrung beispielsweise durch den plötzlichen Tod eines geliebten Menschen entstehen, verstärkt durch die Erfahrung, daran gehindert worden zu sein, diesen in seinen letzten Stunden begleiten oder sich verabschieden zu können. In anderen Fällen könnte es durch den plötzlichen und unerwarteten Zusammenbruch aller beruflichen Perspektiven oder finanziellen Sicherheiten entstehen. Schock, Ohnmachtsgefühle, extreme Verzweiflung, Panik und in deren Folge Fluchtgefühle, Aggression und Kampfhaltung oder auch völlige Erstarrung, sich selbst wie abgestorben fühlen, können Anzeichen für das Erleben eines Traumas sein.
In einer solchen Situation sind neben möglicher staatlicher finanzieller Unterstützung oder professioneller beraterischer oder therapeutischer Hilfe vor allem Menschen in den eigenen Netzwerken bzw. der direkten sozialen Umgebung gefragt. Dies ist natürlich nicht leicht zu bewerkstelligen, solange eine Kontaktsperre gilt. Es geht aber darum, (einen) Menschen in dieser Situation nicht allein zu lassen! Es kann wichtig und moralisch richtig sein, das Gebot der Kontaktsperre in dieser Situation zu ignorieren, um für die betroffene(n) Person(en) tatsächlich da zu sein, ihnen das Gefühl von Nähe zu geben und für ihre Bedürfnisse offen zu sein. Hier geht es also darum, die Risiken gegeneinander abzuwägen: Was wiegt schwerer, das mögliche (kalkulierbare) Risiko einer Infektion oder einer schwerwiegenden psychischen Über-Belastung mit gravierenden Folgen?
In einer solchen Akutsituation ist oft erst einmal das Wichtigste, einfach nur da zu sein, Nähe zu schenken, um das Gefühl des Allein- oder Verlorenseins zu mildern und nicht zu erwarten, dass die Betroffenen erzählen, planen oder darüber nachdenken, wie es weitergehen kann. Vielmehr geht es darum, offen zu sein für das, was von ihnen – oft indirekt – als Signal oder Bedürfnis mitgeteilt wird! Scheinbar simple Dinge, wie beispielsweise eine Tasse Tee oder eine Kleinigkeit zum Essen anzubieten oder zu einem Spaziergang einzuladen, wirken in dieser ersten Schockphase oft mehr als großartige „Gesprächsangebote“. Erst in der zweiten, der sog. Reaktionsphase, kann es hilfreich sein, erzählen zu lassen, darin zu unterstützen, das Erlebte als Realität anzuerkennen, einzuordnen und ggf. zu verstehen. Auch hier können normale alltägliche Dinge hilfreich sein, wie z. B. dem Tag eine Struktur zu geben, einfache Tätigkeiten, wie z. B. den Hund auszuführen oder etwas im Haus zu erledigen. Erst dann kann es in der dritten Phase um die Bearbeitung des Erlebten gehen. Die traumatische Erfahrung wird als ein einschneidendes und schmerzhaftes Erlebnis in der Vergangenheit verortet. Es geht darum, wieder Zugang zu eigenen Kräften und Interessen zu finden, die in der darauf folgenden Phase der Neuorientierung helfen können, das eigene Selbstwertgefühl wieder aufzurichten. Oft können soziale Beziehungen erst jetzt wieder aktiv gestaltet und begonnen werden, neue Zukunftspläne gemacht werden. Menschen in traumatischen Krisen benötigen ein Netz von Gemeinschaft, um sich aufgefangen und verbunden zu fühlen – ohne jedoch durch die „guten Ideen“, normative Vorstellungen oder Fürsorglichkeit ihrer Umgebung entmündigt zu werden. Dies ist ein oft nicht einfacher Balanceakt für Helfer/-innen!
Zusammenfassend kann gesagt werden: Jede Veränderung in unserem Leben kann als Entwicklungsaufgabe verstanden werden und beinhaltet damit eine Herausforderung an unsere Bereitschaft, uns mit neuen Gegebenheiten auseinanderzusetzen und unser Verhalten darauf angemessen abzustellen. Wenn wir dies verweigern, ignorieren, bekämpfen, den Rückzug antreten, in Resignation fallen werden wir wahrscheinlich keine Lösung im Sinne der Verbesserungen unserer Lebenssituation und unserer Befindlichkeit erreichen. Stattdessen werden wir uns immer wieder vor ähnliche Situationen gestellt sehen, bis wir begreifen, dass nicht das Festhalten am Alten, sondern das Bemühen um neue, andere Wege zu Lösungen (auch im Wortsinne) führen werden. Erst dann kann sich wieder ein Gefühl der Erleichterung, Kompetenz und Stolz entwickeln. Nietzsche wird über Max Frisch die Aussage zugeschrieben: Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen! Auch wenn überall von der sog. Corona-Krise gesprochen wird, bedeutet dies nicht, dass alle Menschen diese Zeit tatsächlich als Krise erleben!
Menschen, die aber tatsächlich durch die Corona-Pandemie eine Veränderungs- oder traumatische Krise erleben, brauchen neben ganz handfesten und praktischen Hilfen, wie beispielsweise finanzieller Unterstützung durch den Staat, unkomplizierten Zugang zu professioneller beraterischer oder therapeutischer Hilfe und vor allem ein soziales Netz, das sie auffängt und trägt, ohne sie einzuengen.
Erweitert man den Blick von der individuellen auf die gesellschaftliche Ebene, kann das beschriebene Krisen-Verständnis auch hier nützlich sein: Wenn wir bezogen auf den Klimawandel, die Globalisierung (z. B. die Auslagerung wichtiger Produktionen in Billiglohnländer!), die profitorientierte Privatisierung von Gemeinschaftsaufgaben (z. B. im Gesundheitssystem und im Wohnungswesen) usw. so weiter machen wie bisher, werden Krisen, wie jetzt die Corona-Pandemie, immer wieder gleiche und größere Ausmaße annehmen. Unsere Chance besteht jetzt darin, die Corona-Pandemie als eine Veränderungskrise zu begreifen. Deutschland und die EU verfügen über genügend Mittel und Ressourcen, um konstruktive Veränderungsprozesse in Gang bringen zu können. Was es braucht, ist die Bereitschaft, Verantwortung für die Folgen der bisherigen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen zu übernehmen. Hinzukommen muss der Mut, Veränderungsprozesse zu initiieren, sowie die Einstellung zu verändern, den Profit an oberste Stelle zu setzen. Damit könnte verhindert werden, dass aus der aktuellen Veränderungskrise eine generelle chronisch-protrahierte Krise entsteht.
Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass sich die Corona-Pandemie viel extremer und katastrophaler in Südeuropa, in Afrika und in asiatischen Ländern wie z. B. Indien auswirken wird, wo bereits in sog. „normalen“ Zeiten für einen Großteil der Bevölkerung keine ausreichende medizinische Versorgung zur Verfügung steht – ganz abgesehen von angemessen bezahlter Arbeit, ausreichendem Wohnraum oder Schulbildung für die Kinder. Auch das sollte bei der Einschätzung unserer eigenen „Krise“ in Betracht gezogen werden. Schließlich geht vieles davon in der Welt auf das Konto einer globalisierten kapitalistischen Wirtschaft, von der bisher immer und überwiegend die westlichen Länder profitierten.
O-Ton einer jungen Mutter zur Frage, wie sie die Corona-Krise erlebt: „Krise? Was ist denn hier bei uns Krise? Wenn du wissen willst, was Krise wirklich ist, lege eine Standleitung nach Moria (Flüchtlingscamp in Griechenland – ASB) und schau dir an, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben. Dann weißt du, was Krise ist!“
Ohne die Belastungen, denen Menschen durch die Corona-Pandemie ausgesetzt sind zu verharmlosen: Ein Blick nach Moria, die Townships in Südafrika oder auf die vielen tausend Wanderarbeiter Indiens, die, weil sie ihre kargen Jobs verloren haben, versuchen zu Fuß in ihre zum Teil Hunderte von Kilometern entfernt liegenden Heimatdörfer zurückzukehren, kann das persönliche Krisenerleben deutlich relativieren und die Verantwortlichkeit der westlichen Welt für die Folgen der angeführten Globalisierung erkennbar werden lassen.
Die persönlichen Kompetenzen zur Bewältigung einer individuell erlebten Krise lassen sich auch durch die folgenden Fragen aktivieren:
- Welche Bereiche meines Lebens beeinflusst oder verändert die Pandemie und welche Auswirkungen hat dies konkret für mich? Gibt es Bereiche, in denen (im Moment!) gar nichts mehr geht? Brauche ich Hilfe von außen und kann ich mich darum bemühen?“
- Welche Bereiche in meinem Leben sind nicht davon betroffen? Was läuft gut bzw. normal?
- Welche eigenen (Bord-)Mittel (Fähigkeiten, Ressourcen) habe ich zur Verfügung, um das Problem, vor das mich die Corona-Pandemie stellt, anzugehen?
- Spüre ich erhöhte Aufmerksamkeit oder Wachsamkeit, eine zunehmende innere Aktivierung und Mobilisierung, die mein Interesse an einer Lösung und meine Motivation, einen gangbaren Weg zu finden, wie ein Motor antreibt?
- Oder bin ich sehr aufgeregt, bin äußerst wachsam, skeptisch, misstrauisch und habe ein unbedingtes Bedürfnis, die Kontrolle über alle Abläufe meines Lebens zu behalten? Habe ich große Angst, genau diese Kontrolle zu verlieren und dann in Panik oder Ohnmacht und Lähmung zu verfallen? Kann ich nicht aufhören, hektisch alles Mögliche zu tun, ohne jedoch das Gefühl wiederzuerlangen, tatsächlich die Dinge steuern oder gestalten zu können? Dann brauche ich möglicherweise professionelle Hilfe, um mich neu orientieren und die derzeitige Situation meistern zu können!
- Was genau hat sich für mich durch die Corona-Pandemie verändert? Welche Herausforderung sowie Lern- oder Entwicklungsaufgabe könnte für mich damit verbunden sein? Was soll ich hinzu-lernen oder hinzu-entwickeln, um mit dieser neuen Situation zurechtzukommen?
- Wer oder was kann mich dabei unterstützen, die neue Lebenssituation anzuerkennen, notwendige Veränderungen in meinem Leben anzugehen und nach und nach neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln?
Literatur
Lenz, A. (2007): Freunde in der Not. Die Bedeutung sozialer Netzwerke bei Krisenvorbeugung und Krisenbewältigung. In: Zs. Blätter der Wohlfahrtpflege, 4, S.130–133.
Dross, M. (2001): Krisenintervention. Göttingen: Hogrefe.
Hofer-Moser, O. et al. (2020): Krisenintervention kompakt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Kunz, S. / Scheuermann, U. / Schürmann, I. (2004): Krisenintervention. Ein fallorientiertes Arbeitsbuch für Praxis und Weiterbildung. Weinheim: Juventa.
Lenz, A. (2009): Psychologische Krisenhilfe bei familiären und psychosozialen Krisen. In: Zs. Prävention, Nr. 2, S. 37–41.
Müller, W. / Scheuermann, U., Gahleitner, S.B. (2010): Praxis der Krisenintervention. Stuttgart: Kohlhammer
Schmidt, G. et al. (Hrsg.) (2019): Gut beraten in der Krise. Konzepte und Werkzeuge für ganz alltägliche Ausnahmesituationen. managerSeminar Verlags GmbH, Bonn: Edition Training aktuell.
Sonneck, G. (2000): Krisenintervention und Suizidverhütung. Wien: Facultas
Sonneck, G. (2005): Krisenintervention als Beitrag zur (psychischen) Gesundheitsförderung in Österreich.
URL: http://www.univie.ac.at/lbimgs/present/jf14122005_artikel.PDF.
Annegret Sirringhaus-Bünder
Lehrende für Systemische Beratung und Therapie (DGSF) im Kölner Verein für systemische Beratung e. V., Lehrende für MarteMeo – Videounterstützte Beratung (Licensed Supervisor), Lehrende für NLP (Neuro-linguistisches Programmieren), Systemische Supervisorin (DGSF). Praxis für systemische Beratung, Therapie, Supervision und Coaching in Brühl/Rhld.